Local Energy Systems
Zwischen Zuhören und Mitgestalten: Kommunen in der Wärmeplanung gefragt
Am 16. Juni 2025 fand die zweite Veranstaltung der Online-Reihe »Komm.InFahrt« zum Thema »Partizipation vs. Information in der kommunalen Wärmewende« statt. Veranstaltet wurde der Termin von der Gruppe Kommunale Energiewende und Netztransformation des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT – vertreten durch Dr. Anne Hagemeier und Sarah Borchert.
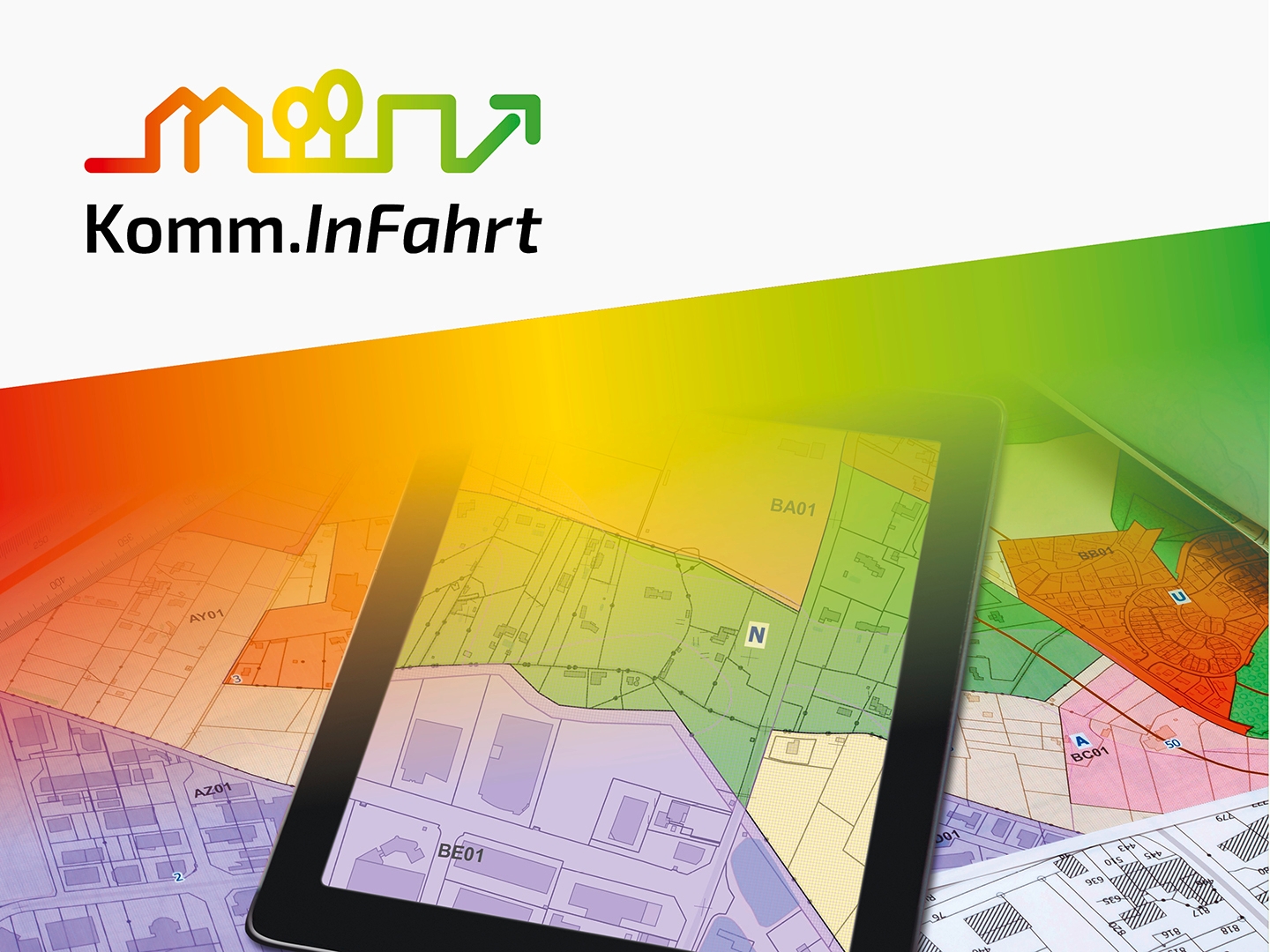
Anne Hagemeier führte in die Veranstaltung ein und stellte dabei das Konzept der Reihe vor: In der Veranstaltungsreihe werden Handlungsoptionen und Lösungen für die kommunalen Wärmwende diskutiert. Die Veranstaltung findet alle drei Monate statt und hat das Ziel, durch das Aufzeigen von erfolgreichen Umsetzungsbeispielen, Impulse für Kommunen zu geben. Dabei wird eine Brücke zwischen Forschung, Planung und Praxis geschlagen. Die Wärmewende sei kleinteilig und betrifft viele Einzelakteure, weshalb eine regelmäßige Kommunikation besonders wichtig sei, erklärte Anne Hagemeier.
Entwicklung eines energetischen Nachbarschaftsquartiers
Im ersten Vortrag stellte Dr. Julia Masurkewitz-Möller das seit 2018 laufende Projekt »Fliegerhorst Oldenburg« vor, in dessen Fokus die Entwicklung eines energetisches Nachbarschaftsquartiers steht. Das Quartier umfasst 124 Wohneinheiten, eine Quartiersgarage sowie eine Kita. Ziel ist die Integration innovativer Energielösungen bei gleichzeitiger Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner. So hatten die Bewohnerinnen und Bewohner beispielsweise die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung selbst Photovoltaikanlagen zu installieren, um so aktiv an der Energiewende mitzuwirken.
Mit Beginn der Corona-Pandemie konnte das Projekt auf digitale Formate ausweichen. So konnte das geplante Lernspiel zur Energiewende, das zur spielerischen Auseinandersetzung mit Energietechnologien einlädt, digital angeboten werden. Ergänzend wurde mit der Plattform »Digitale Werkstatt Helleheide« ein virtueller Raum eingerichtet, der Bürgerinnen und Bürgern sowie Projektbeteiligten den Austausch und die gemeinsame Gestaltung von Ideen ermöglicht. Weitere Formate wie Führungen oder partizipative Innovationscamps erweitern das Angebot.
Aktuell arbeitet die Stadt Oldenburg an einem kommunalen Wärmeplan, welcher durch die Entwicklung eines Wärmekatasters zum bestehenden Solardachkataster ergänzt wird.
Bürgerbeteiligung in Stuttgart
Im zweiten Vortrag präsentierten Constantin Dierstein und Lea Koch von der Stadt Stuttgart drei Partizipationsansätze:
- Bürgerrat Klima: Bürgerinnen und Bürger werden aktiv in die Entscheidungsprozesse eingebunden und können so direkt an der Entwicklung neuer Maßnahmen mitwirken. In sechs Sitzungen erarbeiteten 61 zufällig ausgewählte Teilnehmende insgesamt 25 Empfehlungen, davon 12 zum Thema Mobilität und 13 zur Wärmeversorgung.
- Stuttgarter Wärmewende: Informations- und Beteiligungsformate stärken das Verständnis für die kommunale Wärmeplanung. Präsenzveranstaltungen und moderierte Diskussionsräume sorgen für niedrigschwellige Zugänge.
- Aktion Gebäudesanierung Sillenbuch: Bürgerinnen und Bürger erhalten gezielte Informationen zu Sanierungsmöglichkeiten und Förderprogrammen. Ziel ist die Aktivierung zu individuellen Maßnahmen durch transparente Kommunikation und Netzwerkarbeit vor Ort.
Es folgten Einzelaktionen wie Bürgercafés, ein Zukunftsforum sowie der Aktionstag »Wo drückt der Schuh?« mit direktem Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Energieberaterinnen und -beratern sowie Handwerksbetrieben.
Darüber hinaus stellte Lea Koch das EU-Forschungsprojekt »DigiTwins4PEDs« vor. Ziel des Projekts ist es, Wissenslücken zu Technologien zu schließen und eine positive Einstellung zur Quartierstransformation zu befördern. Bürgerinnen und Bürger werden über eine im Projekt entwickelte Plattform aktiv in die Entwicklung technischer Innovationen eingebunden, um Akzeptanz und Umsetzungschancen zu verbessern.
Beteiligungsformate in der kommunalen Praxis
Im abschließenden Beitrag präsentierte Sarah Borchert von Fraunhofer UMSICHT Erkenntnisse aus 16 Interviews mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern sowie Dienstleistern zur Umsetzung von Informations- und Beteiligungsformaten.
Die Ergebnisse zeigen:
- Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung entschieden sich die meisten Kommunen, auf eine reine Information der Bürgerinnen und Bürger zu setzen. Diese frühzeitig und umfassend zu realisieren ist jedoch sehr wichtig, um eine hohe Akzeptanz, auch für die folgenden Umsetzungsmaßnahmen zu erreichen. Vorwiegend wurden daher Informationsveranstaltungen organisiert, um den Prozess und die Ergebnisse der Wärmepläne transparent darzustellen. Auch die Aktivierung und Befähigung der Bürgerinnen und Bürger für die Umsetzung dezentraler Maßnahmen spielte jeweils eine große Rolle.
- In Bezug auf die transparente Darstellung des Vorgehens oder der Ergebnisse der kommunalen Wärmepläne wurden teilweise Fachexpertinnen und -experten bei den jeweiligen Veranstaltungen eingeladen, um Fragen der Teilnehmenden direkt vor Ort beantworten zu können. Die Fachexpertinnen und -experten wurden hierfür entweder als Referentinnen und Referenten eingeladen, als Teilnehmende einer dem Informationsteil anschließenden Fragerunde oder zu einer Minimesse, wo sie an einen selbstgestalteten Stand Informationsmaterial verteilen konnten.
- Größtenteils wurden die Bürger*innen-Veranstaltungen vor Ort durchgeführt. Dies wurde auch von mehreren Interviewpartner*innen empfohlen, da die Diskussionen und der Austausch in Präsenz offener sind als im digitalen Raum.
- Es gab mehrere Interviewpartner*innen, die angeben haben, dass sie sich vor den jeweiligen Veranstaltungen Sorgen vor einer negativen Stimmung seitens der Bürger*innen oder Unruhestiftung gemacht hatten. Nach Rückmeldung der Interviewpartner*innen war diese Sorge unberechtigt. Stattdessen zeigten die Bürger*innen Interesse an den Ergebnissen, insbesondere an den Möglichkeiten bzw. Potenzialen an ihrem jeweiligen Wohnort sowie an Finanzierungsmöglichkeiten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veranstaltung spannende Einblicke und praxisnahe Anregungen zur Information und Partizipation im Rahmen der Wärmewende bot. Partizipative Formate kamen insbesondere in Quartiersprojekten zum Einsatz, um den Bewohner*innen die Möglichkeit zu geben, Idee und Umsetzung mitzugestalten. In der kommunalen Wärmeplanung, als Planungsprozess und noch ohne konkrete Umsetzung, wurde vor allem auf Informationsformate gesetzt. Bei der darauffolgenden Umsetzung wird anschließend auch die Partizipation relevanter. Der nächste Austausch im Rahmen von »KommInFahrt« ist für den 8. September 2025 von 14:30 bis 16:00 Uhr geplant. Thema: »Datenmanagement in der kommunalen Wärmeplanung«.
Letzte Änderung:
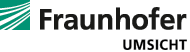 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT