Bioabbaubare Kunststoffe
Kunststoffe, deren Bestandteile bioabbaubar sind.
Der Abbauprozess von bioabbaubaren Kunststoffen kann verschiedene parallel oder nachfolgend ablaufende abiotische und biotische Schritte einschließen, jedoch muss immer der finale Schritt der biologischen Mineralisation dabei sein.
Biologischer Abbau von Kunststoffen findet statt, wenn das organische Material des Kunststoffs als Nährstoffquelle für biologische Systeme (Organismen) genutzt wird.
Bioabbaubare Kunststoffe können auf nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Stärke) oder auf nicht-nachwachsenden/fossilen Rohstoffen basieren (z.B. Erdöl), die in chemischen oder biotechnologischen Prozessen verarbeitet wurden. Die Quelle oder der Prozess, durch den die Materialien hergestellt werden, beeinflussen nicht die Klassifikation als bioabbaubare Kunststoffe.
Der Grad der Bioabbaubarkeit eines Kunststoffgegenstands hängt neben dem speziellen Material auch von dem Oberflächen-Volumen-Verhältnis der Produkte, z. B. ihre Materialdicke, ab.
BASISWISSEN
Mikroorganismen erkennen bioabbaubare Kunststoffe als Nahrung und konsumieren und verdauen sie.
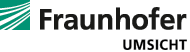 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT