Carbon Management
8. Konferenz zur nachhaltigen chemischen Konversion in der Industrie zeigt Fortschritte und Herausforderungen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie
Am 19. November fand in Düsseldorf sowie virtuell die 8. Konferenz zur nachhaltigen chemischen Konversion in der Industrie im Rahmen des Verbundprojektes Carbon2Chem® statt. Rund 170 Teilnehmende aus Wissenschaft, Industrie, Politik und Verbänden kamen zusammen, um sowohl die Fortschritte des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Projekts als auch nächste Schritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie zu diskutieren. Der Fokus lag dabei auf Carbon Capture and Utilization (CCU).



Eröffnet wurde die Konferenz von den Projektkoordinatoren Prof. Dr.-Ing. Görge Deerberg (Direktor für Transfer bei Fraunhofer UMSICHT) und Dr. Markus Oles. Sie ließen die Entwicklung von Carbon2Chem® von den ersten Ideen bis zur aktuell laufenden dritten Projektphase Revue passieren. Eine der präsentierten Zahlen war die perfekte Überleitung zur anschließenden Videobotschaft von Dorothee Bär: Seit dem Start in 2016 haben fünf Bundesforschungsministerinnen und -minister das Projekt begleitet.
Dorothee Bär hob die Bedeutung der klimaneutralen Energieversorgung für Deutschland hervor: Dieses Ziel zu erreichen sei kein Sprint, sondern ein Staffellauf, an dem viele Läufer*innen beteiligt seien und bei dem Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor sei. Darüber hinaus würdigte die Ministerin das Engagement aller am Projekt Beteiligten und bezeichnete Carbon2Chem® als »Tempomacher für die Energiewende«.
Ein Blick auf die finale Phase von Carbon2Chem®
Prof. Dr. Robert Schlögl, ebenfalls Koordinator von Carbon2Chem®, warf in seiner Keynote einen Blick auf die finale Phase des Projektes. Das wichtigste Ergebnis bislang: Die entwickelten Technologien zur Umwandlung von CO₂ zu Methanol funktionieren – nicht nur in Simulationen, sondern auch in realen Anlagen jenseits des Labormaßstabs. Jetzt gelte es, die Ergebnisse detailliert zu dokumentieren – zum Beispiel in Form einer hochrangigen Publikation – und auch zu kommunizieren. »Nicht nur die Projektbeteiligten müssen wissen, wie die entwickelten CCU-Technologien funktionieren. Alle müssen wissen, dass das, was wir hier erarbeitet haben, funktioniert«, betonte er.
Herausforderungen für die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis sieht Robert Schlögl weniger im technischen als im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Es fehle häufig der Wille, vorhandene Technik tatsächlich einzusetzen, sagte er in seiner Keynote. Während in Deutschland und Europa die Umsetzung stocke, würden in anderen Weltregionen bereits vergleichbare Projekte realisiert. Es reiche nicht aus, auf staatliche Maßnahmen zu warten – alle Akteure seien gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Schließlich steige der Handlungsdruck durch den Klimawandel immer weiter.
CCU-Impulse aus Wissenschaft und Industrie
In eine ähnliche Richtung ging Matthias Belitz in seinem Impulsvortrag. Der Bereichsleiter Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz des VCI e.V. hob hervor: Auf Projektebene sei man in Deutschland schon sehr weit – und gerade Carbon2Chem® sei ein Leuchtturmprojekt, das zeige, wie CCU funktionieren kann. Mit Blick auf die Großskalierung von CCU und auch Carbon Capture and Storage (CCS) stehe man allerdings noch am Anfang.
Dr. Iris Rieth-Menze von NRW.Energy4Climate gab einen Einblick in den Stand der Industrietransformation in NRW und betonte die Bedeutung von CCU-Produkten für zukünftige Wertschöpfungsketten. Sie unterstrich, dass Unternehmen jetzt Konzepte aufsetzen müssen, um die Circular Economy voranzubringen.
Regulatorische Rahmenbedingungen
Ulrich Seifert (Fraunhofer UMSICHT) und Nils Tenhumberg (thyssenkrupp Uhde GmbH) beleuchteten die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen für CCU in Deutschland und Europa. Dabei gingen sie u.a. auf die Herausforderungen bei der Anerkennung von synthetischen Kraftstoffen und die unterschiedlichen Nachhaltigkeitskriterien ein.
Innovationen für Mobilität, Schifffahrt und alternative CO2-Gewinnung
Monika Griefahn, Vorsitzende der eFuel Alliance, stellte die Rolle von eFuels als skalierbare Abnehmer für Carbon2Chem®-Ströme vor – schließlich werde es im Sektor Mobilität immer Prozesse geben, die nicht elektrifizierbar seien. Mit Blick auf die Umsetzung von eFuels-Projekten betonte sie die Notwendigkeit von Technologieoffenheit in allen Sektoren.
Die Produktion von eMethanol in Dänemark stand im Mittelpunkt des Vortrags von Simon Schrickel (European Energy Deutschland GmbH). Dabei ging er u.a. auf Chancen und Hindernisse verschiedener CCU-Märkte ein. Unterschiede in der politischen Fokussierung einzelner Länder würden zu unterschiedlichen Bedingungen für die Umsetzung von Technologien führen. Ein Beispiel: In Großbritannien stünden einem starken Wasserstoff-Förderprogramm ein Fokus auf CCS, regulatorische Hürden und fehlende inländische Absatzanreize für CCU-Produkte gegenüber.
Detlef Wilde (Alfred-Wegener-Institut) sprach über den Einsatz von grünem Methanol auf dem neuen Forschungseisbrecher Polarstern. Eine Herausforderung sei die niedrige Energiedichte von Methanol. Der Tank müsse deshalb doppelt so groß und das Schiff zehn Meter länger gebaut werden. Trotzdem betonte er, dass die Vorteile von Methanol als Kraftstoff überwiegen und er das neue Schiff als Botschafter für Nachhaltigkeit in der Schifffahrt sähe.
Marc Goedekoop (Pure Carbon Blue Corporation B.V.) stellte den Konferenzteilnehmenden das Konzept des Direct Water Capture als alternativen Weg der CO2-Gewinnung vor. Einige der Vorteile – zum Beispiel gegen über Direct Air Capture – seien: einfachere Lagerung und Nutzung, Kompatibilität mit bestehenden Normen und Standards, Kosteneinsparungspotenzial und Energieverbrauch.
Fortschritte in Gasreinigung und CO₂-Abscheidung
Karsten Büker (thyssenkrupp Uhde GmbH) bezog sich wieder auf Carbon2Chem® und berichtete über die Entwicklung der Gasreinigung in Duisburg und die Fortschritte bei der CO2-Abtrennung aus Hüttengasen. Eine der Zahlen, die er vorstellte: Seit 2018 wurden mehr als 4,5 Millionen Nm³ Stahlwerksgase behandelt und verschiedene Konzepte für die Methanolsynthese getestet.
Juliette Poupeney (Revcoo Global Cooling) gab Einblicke in ein System zur CO2-Abscheidung durch kyrogene Verfahren. Dadurch ließen sich 95 Prozent des in Industrieabgasen enthaltenen Kohlendioxids effizient und umweltfreundlich in hochreine, flüssige Form überführen.
Grüner Wasserstoff und Abschlussappell
Klaus Ohlig (thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA) präsentierte Elektrolyse-Lösungen, die durch Modularität und Skalierbarkeit überzeugen und einen wichtigen Beitrag zur Markteinführung von grünem Wasserstoff leisten können. Seine Botschaft: Der Markt habe zwar eine Abschwächung erlebt, aber der Ausblick für grünen Wasserstoff bleibe positiv. Schlüsselfaktoren für den Aufschwung seien u.a. Abnahmevereinbarungen, Wettbewerbsfähigkeit, Regelung und Finanzierungsmodelle sowie die Infrastruktur.
Zum Abschluss der Konferenz richtete Robert Schlögl nochmal einen eindringlichen Appell an die Teilnehmenden. Trotz der vielen vorgestellten Lösungsansätze sei man in Deutschland mit Blick auf eine grüne Transformation der Industrie noch nicht so weit und so gut wie man denke. »Da kommt eine globale Katastrophe auf uns zu, und es ist unsere Verantwortung, aktiv zu werden und etwas gegen die Folgen des Klimawandels zu tun.«
Letzte Änderung:
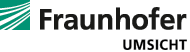 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT