Nachhaltiges Kohlenstoffmanagement
»In Deutschland liegen Emittenten und potenzielle Nutzer von CO2 örtlich nah beieinander: gute Bedingungen, um Kohlenstoff im Kreis zu führen«
Emittenten und Nutzer von CO2 liegen in Deutschland örtlich nah beieinander. Gute Rahmenbedingungen also für ein nachhaltiges Kohlenstoffmanagement und den Einsatz von Carbon Capture and Utilization (CCU) zeigen sich Dr.-Ing. Christoph Glasner und Dr.-Ing. Sebastian Stießel überzeugt. Im Interview beleuchten die UMSICHT-Wissenschaftler Chancen und Herausforderungen von Carbon Management. Dabei stellen sie u.a. innovative technische Ansätze vor, die sowohl zur Defossilisierung der Industrie als auch zur Etablierung neuer Märkte beitragen und zeigen, wie Fraunhofer UMSICHT Unternehmen auf ihrem Weg in eine klimafreundliche Zukunft unterstützt.


Zum Einstieg interessiert mich natürlich: Wie lautet eure – kurze – Definition von Carbon Management?
Christoph Glasner: In meinen Augen steht Carbon Management für einen sinnvollen Umgang mit Kohlenstoff und ist etwas, das in Zukunft zwingend gegeben sein muss. Dabei geht es darum, bilanziell dahin zu kommen, dass wir als Gesellschaft klimaneutral leben. Ein großer Anteil muss dabei sein, dass im Prinzip kein neuer fossiler Kohlenstoff in die Technosphäre eingebracht wird. Denn der könnte perspektivisch wieder in die Atmosphäre gelangen und müsste dadurch an anderer Stelle bilanziell ausgeglichen werden.
Viele sehen den atmosphärischen Kohlenstoff als die Lösung, vergessen aber, dass dieser in der Atmosphäre nur in sehr geringer Konzentration vorliegt. Sprich: Es muss ein entsprechender Aufwand betrieben werden, um reines CO2 zu erhalten. Direct Air Capture (DAC) hat auf dem Weg zu einer nachhaltigen Nutzung von Kohlenstoff durchaus Berechtigung, aber meiner Meinung nach sollten zuerst andere CO2-Quellen, an denen CO2 in deutlich größerer Konzentration vorhanden ist und wo man perspektivisch sowieso Abscheideanlagen benötigen wird, eine größere Rolle spielen. Z.B. Punktquellen in Zement- oder Kalkwerken oder in der Müllverbrennung.
Sebastian Stießel: Daran kann ich nur anschließen: Wir haben in Deutschland, in Europa und weltweit viele Industrien, die wir nicht dekarbonisieren können. Das heißt: Hier wird der Rohstoff bzw. das Medium Kohlenstoff auch in Zukunft ganz wichtig bleiben, so dass neue Lösungen im Umgang gefragt sind: weg von fossilen Quellen, hin zu alternativen Quellen. Bei Carbon Management geht es darum, Spielregeln und Spielfeld für diesen Shift zu schaffen – u.a. von der Politik.
Welche Rolle kann Fraunhofer UMSICHT dabei übernehmen?
Sebastian Stießel: Wir können die Politik dabei unterstützen, Leitplanken zu setzen. Wir können aber auch Unternehmen dabei unterstützen, systemische Lösungen zu entwickeln, um Kohlenstoffströme zu überwachen, zu steuern und zu regeln. Zum Beispiel haben wir systemtheoretische Ansätze und Bewertungsmodelle erarbeitet, mit denen wir solche Ströme identifizieren und monitoren können.
Gibt es im Bereich Politik bereits Projekte?
Sebastian Stießel: Mit dem Land Nordrhein-Westfalen konzeptionieren wir bereits ein Carbon-Monitoring-System, das Grundlage für ein landesweites Carbon-Management-System sein könnte.
NRW hat auch sehr früh – konkret: Ende 2021 – eine eigene Carbon-Management-Strategie verabschiedet. Zielsetzung: das Land zum klimafreundlichsten Industriestandort Europas zu machen, mit einem perspektivisch geschlossenen Kohlenstoffkreislauf. Auf Bundesebene ist man im Mai 2024 nachgezogen.
Christoph Glasner: Die Ursprünge für das Carbon-Monitoring-Projekt lagen übrigens beim Thinktank IN4climate.NRW, an dem Fraunhofer UMSICHT von Anfang an beteiligt war. Da gab es eine AG Kohlendioxidwirtschaft, die in eine Fachgruppe Kohlenstoff übergegangen ist. Dort ist ein Diskussionspapier zur Kohlendioxidwirtschaft erarbeitet worden, das in ganz vielen Bereichen Grundlage für die Carbon-Management-Strategie des Landes NRW ist.
Welche Chancen bietet Carbon Management denn für den Industriestandort Deutschland?
Sebastian Stießel: In Deutschland und insbesondere auch in NRW liegen Emittenten und potenzielle Nutzer von CO2 örtlich nah beieinander. Gute Bedingungen also um Kohlenstoff – zum Beispiel via Carbon Capture and Utilization (CCU) – im Kreis zu führen: Das Zement- oder Stahlwerk muss sein CO2 nicht in die Nordsee verfrachten, sondern kann es direkt an die Kunststoff- oder Kraftstoffindustrie weiterreichen, wo es fossilen Kohlenstoff in Form von Erdgas, Erdöl oder Kohle ersetzt.
Und wenn wir dann den Kohlenstoff erfolgreich im Kreis führen, die entsprechenden Technologien großskalig in die Anwendung gebracht und einen regulatorischen Rahmen für Carbon Management etabliert haben, ergibt sich eine zweite große Chance: Wir können unser Know-how in andere Länder transferieren.
Davon sind wir ja aktuell noch ein Stück entfernt. Wo liegen Hürden?
Christoph Glasner: Die größte Hürde besteht in meinen Augen darin, dass die fossilen Rohstoffe so günstig sind. Da fallen im Grunde nur Förder- und Transportkosten an, während Folgen wie Klimawirkung gar nicht eingepreist werden. Wenn ich aber CO2 im Kreis führen möchte, dann muss ich das abtrennen, reinigen, eventuell wieder verflüssigen. CO2 hat zudem eine sehr geringe spezifische Energie, was es herausfordernd macht, wenn dies als Rohstoff für Stoffe genutzt wird, die eine deutlich höhere spezifische Energie haben. Ich muss also wieder Energie reinstecken, um zu einem Stoff zu kommen, der besser nutzbar ist. Das alles macht es schwierig, vergleichbare Wettbewerbsbedingungen zu fossilen Rohstoffen zu bekommen.
Was müsste sich ändern, damit das passiert?
Christoph Glasner: Aktuell müssen Zertifikate abgegeben werden, wenn CO2 emittiert wird. Das Kontingent an kostenlosen Zertifikaten für Unternehmen wird in den kommenden Jahren sukzessive weniger. 2034 wird es gar keine kostenlosen Zertifikate mehr geben. Durch diese Verknappung wird angereizt, dass weniger CO2 emittiert wird, weil entweder zusätzliche Zertifikate (sofern verfügbar) gekauft werden müssen oder alternativ Strafzahlungen fällig werden. Dieser Mechanismus begünstigt zunehmend die Kreislaufführung von CO2 – theoretisch. Theoretisch nur deshalb, weil die Regulierung auf EU-Ebene derzeit entstehendes CO2 in ETS-pflichtigen Anlagen (Emissions Trading System) schon als emittiert betrachtet und auch hierfür schon Zertifikate abgegeben werden müssen. Damit werden CCU-Prozesse in der EU zusätzlich wirtschaftlich belastet. Gleichzeitig steht man heutzutage im weltweiten Wettbewerb. Selbst wenn wir in der EU die passenden Rahmenbedingungen hätten, es in den USA aber weiterhin »drill, drill, drill« heißt, dann wird es schwierig für konkurrenzfähige CCU-Produkte.
Mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) soll zumindest der Handel über EU-Grenzen hinweg fair gemacht werden. Während innerhalb der EU das Emissionshandelssystem greift, so gibt es dieses System in Drittstaaten und damit einhergehend eine Kostenbelastung für Produkte nicht. Das System soll regeln, dass CO2-intensive Produkte mit einer Art Strafzoll belegt werden, wenn sie in die EU verkauft werden. Emissionsärmere Produkte aus dem EU-Ausland müssten weniger Strafzoll zahlen und hätten somit einen Wettbewerbsvorteil. Sofern es im Drittstaat selbst ein CO2-Bepreisungssystem gäbe, könnte dieses mit dem Strafzoll verrechnet werden. Das soll insgesamt den Klimaschutz anreizen. Inwieweit das funktioniert, bleibt abzuwarten. Unternehmen sind nicht zwingend an einen Verkauf in die EU gebunden, solange es genug andere Abnehmer gibt. Letztlich kann globaler Klimaschutz nur funktionieren, wenn genug mitmachen. Wieviel »genug« sind, ist allerdings eine spannende Frage.
Sebastian Stießel: CO2 muss einen internationalen Preis bekommen. Damit müssen wir starten. Und die Bereitschaft muss auf allen Ebenen da sein. Ein Drei-Personen-Haushalt muss bereit sein, 35 Euro CO2-Kosten im Jahr zu bezahlen. Und auch ein Industriekonzern, der sich auf mehreren Kontinenten austobt, muss bereit sein, einen gewissen Anteil seiner Marge abzugeben, um CO2-Kompensationen zu zahlen. Diese Einnahmen können dann dazu beitragen, die teilweise noch sehr hohen Produktionskosten für CCU-Produkte zu decken.
Christoph Glasner: Wir müssen bei diesem Thema wirklich alle mitnehmen – die Gesellschaft ebenso wie die Wirtschaft. Und da sehe ich Fraunhofer UMSICHT tatsächlich in der Pflicht, dazu zu kommunizieren und ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten.
Gibt es bereits Aktivitäten in dieser Richtung?
Christoph Glasner: Mit der Ausstellung »Power2Change – Mission Energiewende« ist da schon ein wichtiger Schritt gemacht: Wir sind an der Koordination des dahinterstehenden Verbundprojektes »Wissenskommunikation Energiewende« beteiligt, und die Inhalte stammen u.a. aus dem Verbundprojekt Carbon2Chem®, wo es ja darum geht, Bausteine für einen Kohlenstoffkreislauf zu entwickeln. Zudem ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit auch bei IN4climate.NRW verortet. Aber darüber hinaus kommunizieren wir – zumindest momentan – nicht in die Breite der Gesellschaft, sondern eher auf Fachebene.
Was gäbe es denn schon zu kommunizieren? Sprich: Was geht technisch schon in Sachen Kohlenstoffkreislauf?
Christoph Glasner: Da geht schon ganz viel. Natürlich ist da noch viel Luft nach oben, was Effizienz, Reinheit oder Scale-up angeht. Aber im Grundsatz ist es technisch möglich, Kohlenstoff – über den Zwischenzustand CO2 – im Kreis zu führen.
Sebastian Stießel: Tatsächlich müssen wir da zwischen den einzelnen Schritten unterscheiden: CO2 entsteht in irgendeinem industriellen Prozess, kann abgetrennt, transportiert und dann anschließend wieder genutzt werden. CO2-Abtrennung machen wir teilweise schon seit Jahren. In Stein- und Braunkohlekraftwerken sind beispielsweise schon seit langer Zeit Abtrennungstechnologien mit verschiedenen Lösungsmitteln, Adsorbenzien etc. getestet worden. Jetzt ist man dabei, die bisherige Anlagentechnik auf andere Anwendungsfälle und Industrien zu übertragen – bis hin zur Abtrennung von CO2 in ganz niedriger Konzentration aus der Luft.
Auch mit Blick auf den Transport sind wir sehr weit: In den USA wird CO2 in langen Pipelines durch das Land bewegt. Da gibt es also genug Erfahrungen, was technisch geht und was nicht.
Der letzte Block ist dann die Nutzung von CO2 als Rohstoff. Dazu laufen viele Projekte in ganz unterschiedliche Richtungen – also mit verschiedenen Endprodukten als Ziel. Mit der Produktion von Methan ist man schon sehr weit. Auch da gibt es Anlagen, die man von der Stange kaufen kann. Auch mit Blick auf Methanol ist man sehr weit – wie das Verbundprojekt Carbon2Chem® eindrucksvoll zeigt: Seit Sommer 2023 wird in einer Demonstrationsanlage am Stahlwerk der thyssenkrupp Steel Europe AG in Duisburg Methanol produziert – betrieben mit Gasen der laufenden Stahlproduktion.
Im Grunde lässt sich das Ganze mit der Weinherstellung vergleichen: Die Grundprinzipien sind erkannt, und es lässt sich ein ganzes Potpourri an Weinen mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen herstellen. Und das gilt auch für die CCU-Welt. Die bekannten Prozesse lassen sich anpassen, um andere Produkte herzustellen – zum Beispiel Ameisensäure, Ethylen als Grundchemikalie für die Kunststoffindustrie oder auch Synthesegas. Das sind zum Teil hochwertige Produkte mit einem hohen Preis, die am Markt vielleicht schneller Fuß fassen könnten.
Das heißt: Wir müssen ins Machen kommen?
Sebastian Stießel: Ja. Wir haben bereits einige Anlagen und Prototypen im Testbetrieb bei unseren Industriepartnern laufen. Wenn wir diese Anlagen ein zweites oder drittes Mal gebaut haben, dann werden sie natürlich günstiger. Und wenn wir das auf die Industrie übertragen, die die Anlage 100 Mal baut, dann kommen »Economies of Scale« und Effizienz zum Tragen, und die spezifischen Produktkosten sinken.
Und von der Abnehmerseite muss natürlich folgender wichtiger Impuls kommen: Wir stellen hier ein Produkt her, dass sonst auf fossilem Kohlenstoff basiert. Wir brauchen das kohlenstoffbasierte Produkt in der Zukunft, aber der Kohlenstoff soll aus einer nachhaltigen Quelle bereitgestellt werden. Dadurch entsteht zunächst noch ein Mehraufwand gegenüber der konventionellen Herstellung, der in Form von einem »Green Premium« oder wie auch immer bepreist werden muss. Und wenn dann noch der Faktor reinspielt, dass CO2 global gesehen immer teurer wird, dann haben wir hoffentlich bald einen Markt, der von allein läuft und in dem es sich lohnt, in CO2-basierte Produkte zu investieren.
Wer wären die Player in diesem Markt?
Sebastian Stießel: Auf der einen Seite die großen CO2-Emittenten. Für die ist entscheidend, ob sie das CO2 abtransportieren oder vor Ort in die Wertschöpfung bringen wollen. Und auf der anderen Seite die Hersteller von bestimmten Chemikalien oder generell von Kohlenwasserstoffen, die ein Interesse daran haben, bisherigen fossilen Input durch einen neuen, nachhaltigen Rohstoff zu ersetzen.
Wie kann Fraunhofer UMSICHT zur Entwicklung dieses Marktes beitragen?
Sebastian Stießel: Bei unserem Portfolio unterscheide ich gerne zwischen Hard- und Software. Wir können systemtechnisches Know-how liefern. Konkret: Bewertungs- und Optimierungsmodelle für CCU und CCS (Carbon Capture and Storage). Wir können Studien, Standort- oder Lifecycle-Analysen durchführen: Welche Syntheseprodukte bieten sich für den jeweiligen Standort an? Wie wird das CO2 anschließend gebunden? Und wie grün ist das finale Produkt dann letztlich?
Dem gegenüber steht die Hardware: konkrete Prozesse und Anlagen, die wir entwickeln. Die reichen vom Katalysator, der die Reaktion beschleunigen soll, über den Stack oder Reaktor, der das Herzstück einer CCU-Anlage darstellen kann, bis zum Gesamtsystem, das wir unseren Kunden mehr oder weniger schlüsselfertig mit Hilfe unserer Partner aus dem Anlagenbau anbieten können.
Über Carbon2Chem® haben wir bereits gesprochen. Gibt es weitere Beispiele für unsere aktuelle Forschung im Bereich Carbon Management?
Sebastian Stießel: Ein schönes Beispielprojekt ist für mich »Leuna 100«, wo wir mit einem großartigen Konsortium zusammenarbeiten. Das Besondere: Das Projekt ist in einen Chemiepark eingebettet und findet nicht auf der grünen Wiese statt. Konkret geht es um ein neues Herstellungsverfahren von grünem Methanol für Schiff- und Luftfahrt. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer containerbasierten Lösung für die CO2-Elektrolyse zur Erzeugung von Synthesegas.
Ein weiteres Beispiel ist »CO2-Syn – Stoffliche CO2-Nutzung aus Zementwerkprozessgasen mit gekoppelten elektrochemischen und thermisch katalysierten Prozessen« mit dem Ziel, CO2-haltige Abgase aus der Zementindustrie nachhaltig zu nutzen. Konkret soll eine neuartige Prozesskette entstehen, um die Synthese von Olefinen und höheren Alkoholen aus Kohlendioxid-Prozessgasen zu ermöglichen. Der eingeschlagene Lösungsweg heißt »Power-to-Chemicals«. Dabei werden erneuerbare Energien wie Windkraft genutzt, um CO2 und Wasser via Elektrolyse in Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff umzusetzen. Gemische aus diesen beiden Stoffen – so genannte Synthesegase – werden anschließend eingesetzt, um mittels weiterer katalytischer Konversionsverfahren die gewünschten chemischen Produkte herzustellen.
Ein Projekt mit Schwerpunkt Direct Air Capture (DAC) ist »Air2Chem: Gepaarte Elektrosynthese von Basis- und Wertchemikalien über natürlich windgetriebene direkte CO2-Abschiedung aus Luft mittels Membran-Gas-Absorption und Carbonat-Elektrolyse«. Am Ende soll ein integriertes Verfahren stehen, das den DAC-Prozess mit einer elektrolytischen Konversion der carbonathaltigen Absorberlösung verbindet und so die Herstellung wichtiger Plattformchemikalien möglich macht.
DAC spielt übrigens auch eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von nachhaltigen synthetischen Luftfahrtreibstoffen – sogenannten Sustainable Aviation Fuels (SAF). So wie es aktuell aussieht, werden zumindest Langstreckenflüge für die nächsten 100 Jahre noch mit Kohlenwasserstoffen arbeiten. Und via DAC könnte z.B. das über die Triebwerke emittierte CO2 bilanziell wieder aufgefangen und weiterverarbeitet werden. Hierzu entwickeln wir aktuell sehr spannende Projekte mit namenhaften Akteuren in der Branche. Das Einfangen von CO2 aus der Luft ist aufgrund des geringen Partialdrucks noch sehr energieintensiv, neue energieärmere Ansätze sind aber bereits in der Entwicklung. Einen wesentlichen Vorteil, den wir sehen, ist, dass wir das CO2 durch DAC dort bereitstellen können, wo temporär viel Energie zur Verfügung steht, beispielsweise in sonnenreichen Wüsten- und Küstenregionen. Das wären dann spannende Regionen, um unsere Technologien zu exportieren.
Wenn jetzt jemand Interesse hat, mit Fraunhofer UMSICHT ein eigenes Projekt aufzusetzen: Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Christoph Glasner: Das ist tatsächlich sehr individuell und hängt natürlich ganz davon ab, wo der Schuh gerade drückt: Sprechen wir mit jemandem, der sein CO2 – salopp ausgedrückt – loswerden möchte, oder mit jemandem, der andere Stoffe substituieren möchte.
Sebastian Stießel: Als erstes müssten wir schauen, wo der Kunde momentan steht: An welchen Prozessen ist er vielleicht schon dran? Können wir da schon aufsatteln mit laufenden Vorhaben? Oder fangen wir bei null an und schauen, wie eine Carbon-Management-Strategie aussehen könnte? Startpunkte könnten dann eine Machbarkeitsstudie oder eine Standortanalyse sein, um zu schauen, wo die Potenziale liegen. Auf dieser Basis könnten wir dann den Blumenstrauß an möglichen Lösungen, die wir anbieten könnten, verringern. Im Bestfall kommen wir auf ein oder zwei Zielrouten, die wir entweder selbst oder mit Unterstützung von Netzwerkpartnern entwickeln und umsetzen können. Insbesondere im Bereich Sustainable Aviation Fuels (SAF) entwickeln wir gerade sehr spannende Prozesse, die dazu beitragen werden, die Produktionskosten von SAF in der Zukunft erheblich zu senken. Auch hier gilt: Je schneller wir mehr Anlagen im Testbetrieb unter realen Industriebedingungen haben, desto schneller werden wir große Industrieanlagen sehen, die uns helfen, die gemeinsamen, globalen Klimaziele zu erreichen und die spezifischen Produktionskosten zu reduzieren.
Letzte Änderung:
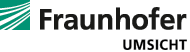 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT