Local Energy Systems
»Die große Stärke der kommunalen Wärmeplanung: Sie bringt alle Akteure an einen Tisch – von Verwaltung über Stadtwerk und Netzbetreiber bis zur Wohnungswirtschaft«
Wie können Kommunen ihre Wärmeplanung sektorübergreifend gestalten und erfolgreich umsetzen? Welche Werkzeuge unterstützen auf dem Weg zur treibhausgasneutralen Wärmetransformation? Mit diesen Fragen befassen sich unsere Forschenden aktuell in verschiedenen Projekten. Guter Ausgangspunkt für ein einordnendes Interview zur kommunalen Wärmeplanung mit Christoph Goetschkes aus der Abteilung Energiesysteme.

Zum Einstieg: Warum ist kommunale Wärmeplanung aktuell so ein wichtiges Thema?
Christoph Goetschkes: Weil sehr viel davon abhängt. Die kommunale Wärmeplanung soll zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen und den Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energien ebnen. Gleichzeitig soll sie eine stabile und kosteneffiziente Wärmeversorgung gewährleisten. Konkret: Wer ein Eigenheim oder Mehrfamilienhaus besitzt, muss sich mit der Frage befassen, wie das Gebäude zukünftig klimaneutral gestaltet werden kann. Der kommunale Wärmeplan hilft, dabei den richtigen Weg einzuschlagen: Investiere ich jetzt in eine dezentrale Lösung wie eine Wärmepumpe oder warte ich, bis in einigen Jahren ein Wärmenetzgebiet entstanden ist?
In welchem Rahmen findet die kommunale Wärmeplanung statt?
Christoph Goetschkes: Sie umfasst im Grunde vier Hauptbestandteile: (1) die Bestandsanalyse (die Erfassung der aktuellen Wärmeversorgung und -nutzung), (2) Potenzialermittlung und Bewertung erneuerbarer Energiequellen, (3) die Aufstellung eines Zielszenarios für 2045 inkl. einer Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs und -nutzung der Kommune und (4) die Entwicklung einer Wärmestrategie (für die Planung von Wärmeverteilungsnetzen, einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der Planung unter Einbeziehung von Stakeholdern, Bürgerinnen und Bürgern). Damit müssen Großstädte ab 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, bei kleineren Kommunen bis zum 30. Juni 2028 durch sein.
Das heißt: Bei den Kommunen ist gerade einiges in Bewegung. Wo liegen die größten Herausforderungen?
Christoph Goetschkes: Die größte Herausforderung sind in meinen Augen die Bestands- und Potenzialanalyse und die damit notwendige, zeitaufwendige Beschaffung von Daten. Durch Geoinformationstools wird ein bestimmtes Raster schon bereitgestellt. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Aber im Endeffekt muss sich jede Kommune anschauen: Wie ist der aktuelle Gebäudebestand? In welchem Zustand sind die Industriegebiete? Wo sind Flächen, die wirklich genutzt werden können? In einem Naturschutzgebiet lässt sich beispielsweise keine Grundwasserwärme nutzen und nicht jedes Wohngebiet lässt sich sinnvoll an die Fernwärme anbinden. Deshalb sind mit den Kommunen auch oft die Grundversorger mit im Boot oder führen im Auftrag der Kommune die kommunale Wärmeplanung aus. Vielen Kommunen liegen häufig nicht alle Daten vor. Sie haben aber – dank des neuen gesetzlichen Rahmens – das Recht, die notwendigen Daten zu erlangen, zum Beispiel bei Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern.
Das ist übrigens auch die große Stärke der kommunalen Wärmeplanung: Sie bringt alle Akteure an einen Tisch – von der Verwaltung über das Stadtwerk bis zu zur lokalen Wohnungswirtschaft. Auch der Verteilnetzbetreiber sollte integriert werden. Er muss nämlich schauen, wie hoch die Belastung werden könnte, wenn viele Wärmepumpen in einem bestimmten Gebiet gebaut werden, und dies in seinen Ausbauplänen berücksichtigen. Diese Zusammenarbeit kann die Grundlage sowohl für gegenseitiges Verständnis als auch für weitere Kooperationen sein. Da kann eine gemeinsame Planungsbasis geschaffen werden, von der man lange zehrt.
Und was passiert, wenn der Plan steht?
Christoph Goetschkes: Wenn der Wärmeplan steht, ist er erst einmal für alle einsehbar. Danach beginnt die Umsetzung des Wärmeplans, um die Kommune auf den Weg Richtung Zielszenario zu bringen. Als Gebäudeeigentümer*in weiß ich jetzt, ob ich ein Fernwärmeanschluss realistisch ist oder nicht. Ist ein Netzgebiet ausgewiesen, können ein Stadtwerk oder andere Akteure schauen, wie es konkret in die Umsetzung kommt: Wird eine detaillierte Machbarkeitsstudie erstellt und ein Wärmenetz gebaut? Oder wird ein Transformationsplan für ein bestehendes Netzgebiet erstellt, um ein Gebiet klimaneutral zu bekommen? Da kommt dann die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) zum Tragen, die das Ganze parallel flankiert: Wer ein Wärmenetz installieren oder transformieren möchte, wird dabei modular unterstützt: (1) Machbarkeitsstudien und Transformationspläne, (2) die systemische Förderung für Neubau und Transformation von Wärmenetzen, (3) Einzelmaßnahmen bestehender Netze sowie (4) die Betriebskostenförderungen für Integration erneuerbarer Energien (Wärmepumpen und Solarthermie). Bei der Umsetzung sollten die in der kommunalen Wärmeplanung etablierten Zusammenarbeits- und Kommunikationswege zwischen den relevanten Akteuren weiter genutzt werden. Die Kommune hat hier weiterhin eine koordinierende Funktion, kann Bürger*innen unterstützen und die geplanten Maßnahmen in den eigenen Planungsprozessen verankern.
Was sind die Themenschwerpunkte von Fraunhofer UMSICHT auf dem Weg zur Wärmewende?
Christoph Goetschkes: Wir arbeiten sowohl in Direktaufträgen mit Stadtwerken, Wärmenetzbetreibern und Kommunen an der Konzepterstellung für konkrete Standorte als auch an verschiedenen öffentlich geförderten Projekten rund um die Wärmeplanung, in denen wir übertragbare Unterstützungswerkzeuge und Formate für die Akteure der Wärmewende entwickeln.
Ein Beispiel für ein solches Forschungsprojekt ist »PlaWaTT«. Dort bewerten und charakterisieren wir gemeinsam mit dem Stadtwerke-Verbund ASEW vorhandene Werkzeuge und Maßnahmen zur Wärmeplanung und stellen sie anschließend über eine Online-Plattform zur Verfügung. Das ist gerade für kleinere Kommunen mit einem geringen Budget interessant, die ja auch noch bis 2028 Zeit haben, ihren kommunalen Wärmeplan vorzulegen. Zur Vernetzung stellen wir unter dem Titel »PlaWaTT Insights« praxisnahe und relevante Informationen rund um Wärmeplanungstools und -maßnahmen aus dem Projekt zur Verfügung.
Zudem haben wir den »Forschungs- und Entwicklungscluster zur Verknüpfung von kommunaler Wärmeplanung mit der Umsetzungsplanung von integralen Maßnahmen im Quartier« – kurz: »KommWPlanPlus« – initiiert. Darin untersuchen wir mit der items GmbH & Co. KG, der Stadt Wuppertal, der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, der Stadt Hagen, der Enervie Service GmbH, der Stadt Garbsen und der Stadtwerke Garbsen GmbH sowie dem Verein Civitas Connect e. V. als Netzwerkpartner, wie die kommunale Wärmeplanung als langfristige Planungsaufgabe organisatorisch und technisch verstetigt und mit Blick auf sich ändernde Anforderungen in Richtung einer integrierten Umsetzungsplanung weiterentwickelt werden kann. Das Besondere: In Wuppertal, Hagen und Garbsen laufen parallel zum Projekt kommunale Wärmeplanungen, so dass die praktischen Arbeiten die wissenschaftlichen Arbeiten flankieren.
Zudem möchten wir mit den beiden Online-Veranstaltungsreihen SW.aktiv und Komm.InFahrt praktische Erfahrungen und Lösungsansätze für die kommunale Energiewende vorstellen und Ergebnisse aus der Forschung in die Praxis bringen. Die beiden sich an Stadtwerke und Kommunen richtenden Veranstaltungen finden viermal jährlich in einem kompakten Online-Format statt.
Und wie sieht es an einem konkreten Standort aus? Wie könnt ihr dort unterstützen und wie funktioniert die Zusammenarbeit dort?
Christoph Goetschkes: Für den konkreten Standort führen wir aktiv Machbarkeitsstudien und Transformationspläne gemäß der BEW durch. Dort unterstützen wir Stadtwerke, Wärmenetzbetreiber und kommunale Unternehmen im Direktauftrag, der sich über das Modul I der BEW mit 50 Prozent fördern lässt. Auch bei der Umsetzung von Wärmenetzen gibt es im Rahmen von Modul II der BEW eine Förderung von bis zu 40 Prozent auf die Investition. In den drei Jahren, in denen die BEW aktiv ist, haben wir erfolgreich mehrere Machbarkeitsstudien und Transformationspläne realisiert, aus denen wir wertvolle Erfahrungswerte zur BEW gewonnen haben. Dies bedeutet für unsere Auftraggeber, dass sie neben dem Transformationsplan bei relevanten Fragen zur Förderfähigkeit einzelner Anlagen und den notwendigen Folgeschritten für eine erfolgreiche Umsetzung prozessbegleitend unterstützt werden.
Zudem denken wir in unserer Forschung über die einzelne Machbarkeitsstudie oder den Transformationsplan hinaus. Gerade deshalb sind Praxispartner aus der Nah- und Fernwärmebranche neben den Direktaufträgen für unsere öffentlich geförderte Projekte hochrelevant. Die anwendungsnahe Forschung zeichnet Fraunhofer UMSICHT aus.
Letzte Änderung:
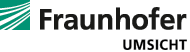 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT