Carbon2Chem®
»Wenn wir CO2 aus Stahlwerken in Grundchemikalien umwandeln wollen, müssen wir die gesamte Wertschöpfungskette im Blick behalten«
Das Teilprojekt »Systemintegration« ist das Herzstück von Carbon2Chem®: Hier werden alle Ergebnisse zusammengeführt und technologische Transformationspfade zur Kreislaufführung von CO2 aus industriellen Prozessgasen erarbeitet und bewertet. Wie das in der Praxis gelingt und welche Tools dabei zum Einsatz kommen, erläutert Dr.-Ing. Thorsten Wack im Interview.

Mit welchem Ziel ist das Teilprojekt »Systemintegration« in die dritte Phase von Carbon2Chem® gestartet?
Thorsten Wack: Wir haben natürlich auch in der dritten Phase das übergeordnete Ziel von Carbon2Chem® fest im Blick: einen nennenswerten Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten und CO2-Emissionen zu reduzieren. In der zweiten Phase haben wir dabei schon über die Grenzen des Stahlwerks hinaus auch auf andere Branchen geschaut – wie zum Beispiel Zement und Kalk.
Im Teilprojekt »Systemintegration« haben wir dabei in der ersten Phase Grundlagen ermittelt, um anschließend in Labor und Technikum eine ganze Reihe an systemischen Dingen zu erforschen. In der dritten und letzten Phase sind wir angetreten, um einzelne Technologien und ihr Zusammenwirken auf systemischer Ebene zu untersuchen und schließlich in einen industriellen Maßstab zu integrieren. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass sich eine Anlage im industriellen Maßstab über 20 bis 30 Jahre rechnen und dann auch so skaliert sein muss, dass das sie dem Transformationspfad standhält. Am Ende soll eine Art Blaupause stehen, mit deren Hilfe sich solche Anlagen bauen lassen.
Wie würdest du »Transformationspfad« übersetzen?
Thorsten Wack: Der Transformationspfad beschreibt den Prozess, den Industrien wie die Stahl- oder Zementindustrie durchlaufen, um ihre Produktionsmethoden zu ändern; dies mit dem Ziel, ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren und umweltfreundlicher zu werden. Beispielsweise wird die Stahlindustrie von traditionellen Hochöfen, die Koks und Kohle verwenden, zu Direktreduktionsanlagen gehen, die Wasserstoff oder grünes Methan nutzen. Dieser Prozess wird nicht über Nacht geschehen, sondern sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Der Transformationspfad umfasst also technische Innovationen und Anpassungen in den Produktionsprozessen, um die angestrebten Umweltziele zu erreichen.
Wie geht ihr bei der Zusammenführung bisher entwickelter Technologien und der Integration in Anlagenkonzepte vor?
Thorsten Wack: Wir verfolgen einen strukturierten Ansatz, der sich auf die Expertise unserer interdisziplinären Communities stützt. Diese Communities setzen sich aus Fachleuten zusammen, die sich auf verschiedene Aspekte wie beispielsweise Simulation, Lebenszyklusanalyse (LCA) und energetische Integration konzentrieren. Der Prozess beginnt mit der Aggregation aller relevanten Informationen, die im Rahmen von Carbon2Chem® bislang gesammelt wurden. Dabei entwickeln wir integrierte Prozesskonzepte, um zu klären, wie die Anlagen betrieben werden können, zum Beispiel durch die Nutzung unterschiedlicher Gasquellen wie Hochofengas, Konvertergas oder Koksofengas. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Beantwortung der Frage, wie viel CO₂-Emissionen vermieden werden können, abhängig von der Skalierung der Anlage und der Dynamik der Märkte in den kommenden zehn bis 20 Jahren.
Ein weiterer zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die wir in Bezug auf die Anlagen vornehmen. Dabei setzen wir fortschrittliche Berechnungsmethoden und Simulationstechniken ein, um die Funktionsfähigkeit der Prozesskonzepte fundiert und quantifiziert zu untersuchen. Das ermöglicht uns, belastbare Aussagen darüber zu treffen, wie die Anlagen später funktionieren und welche finanziellen Erträge zu erwarten sind – Aspekte, die insbesondere für Investoren von großem Interesse sind.
Das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor.
Thorsten Wack: Das ist in der Tat. Deshalb ist das Teilprojekt »Systemintegration« auch so umfangreich und bezieht ganz unterschiedliche Partner ein – von der Industrie über die Universitäten bis zur thyssenkrupp Vermögensverwaltung.
Eine der größten Herausforderungen besteht in meinen Augen darin, die verschiedenen Systembausteine zu integrieren. Wenn wir CO₂ aus Stahlwerken in Grundchemikalien umwandeln wollen, reicht es nicht aus, Einzeltechnologien wie einen Methanolreaktor zu entwickeln. Vielmehr müssen wir die gesamte Wertschöpfungskette im Blick behalten, einschließlich der Marktbedingungen und der Auswirkungen auf den Weltmarkt. Deshalb ist es entscheidend, dass wir mit den beteiligten Partnern sowohl die technischen Aspekte betrachten als auch die Wechselwirkungen mit der Umwelt und dem Markt berücksichtigen.
Wie geht ihr dabei praktisch vor? Setzt ihr auch auf Künstliche Intelligenz?
Thorsten Wack: Wir setzen in der dritten Phase von Carbon2Chem® auf die in den ersten beiden Phasen entwickelten Tools, die speziell für Lebenszyklusanalyse (LCA) und deren Integration in Betriebskonzepte konzipiert wurden. Diese Tools ermöglichen es uns, dynamisch auf die Verfügbarkeit von CO₂ und grünem Wasserstoff zu reagieren, indem Anlagen entsprechend hoch- oder heruntergefahren werden.
Unser Ansatz erfordert eine zeitgesteuerte Analyse, bei der wir stündlich die Eingangs- und Ausgangsdaten sowie den CO₂-Verbrauch überwachen. Hierbei kombinieren wir dynamische Simulationen mit LCA-Methoden, um die Nachhaltigkeit und Effizienz unserer Konzepte zu bewerten.
Die Nutzung von KI ist dabei tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Wir haben begonnen, die Erkenntnisse aus den ersten beiden Phasen zu verwenden, um ein multimodales Large-Language-Modell zu trainieren. Dieses KI-Modell soll uns helfen, Betriebskonzepte unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu entwickeln und zu optimieren. Dabei ist wichtig: je größer die Trainingsbasis, desto präziser und nützlicher die KI.
Was passiert mit all diesen Tools nach dem Abschluss von Carbon2Chem®?
Thorsten Wack: Am Ende des Verbundprojektes sollen die erarbeiteten Carbon Dioxide Capture and Utilization (CCU) Lösungen über eine Technologieplattform zur Verfügung gestellt werden – darunter sogenannte »CCU-Ökosysteme«, die den Schritt in die Umsetzung der Forschungsergebnisse unterstützen. Unsere Tools tragen zwar wesentlich zu der Generierung dieser Ergebnisse bei, werden aber selbst nicht auf dieser Plattform veröffentlicht. Allerdings können sie selbstverständlich in andere Projekte integriert werden und stärken dadurch die wissenschaftliche Ausrichtung und die Reputation von Fraunhofer UMSICHT.
Was genau ist ein »CCU-Ökosystem«?
Thorsten Wack: Es bezeichnet das Zusammenspiel und die Integration verschiedener technologischer Komponenten, die es ermöglichen, CO₂ als Rohstoff in wertvolle chemische Produkte umzuwandeln. Unterschiedliche Branchen haben spezifische Voraussetzungen und Herausforderungen, die unterschiedliche Ansätze erfordern.
Ein Beispiel wäre die Möglichkeit, eine großflächige Methanolanlage zu errichten, wenn eine geeignete CO₂- und Wasserstoffinfrastruktur vorhanden ist. In einem CCU-Ökosystem arbeiten verschiedene technologische Komponenten an verschiedenen Standorten zusammen, um CO₂-haltige Gase effizient zu erfassen, zu reinigen und in den Produktionsprozess einzuführen. Dieses integrierte System ermöglicht eine umfassende Wertschöpfungskette und eine nachhaltige Nutzung von CO₂, die bis zum Markt reicht.
Und zum Abschluss: Was ist für dich das Erfolgsrezept von Carbon2Chem®?
Thorsten Wack: Das Erfolgsrezept von Carbon2Chem® liegt in der engen Zusammenarbeit und Integration der verschiedenen Teilprojekte über alle drei Phasen hinweg. Sie agieren nicht isoliert, sondern verfolgen gemeinsam gesteckte Ziele. Dadurch ist über die Jahre ein bemerkenswerter und konstruktiver Zusammenhalt entstanden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Vertrauen zwischen den beteiligten Partnern in Kombination mit einer außergewöhnlichen Projektstruktur, die eine effektive Integration der Teilergebnisse fördert.
Zusätzlich wird durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt sichergestellt, dass alle Partner motiviert sind, gemeinsam an den Zielen zu arbeiten. Diese kollaborative Herangehensweise ist entscheidend für den Gesamterfolg von Carbon2Chem® und ermöglicht uns, innovative Lösungen zur Nutzung von CO₂ zu entwickeln.
Letzte Änderung:
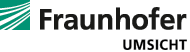 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT