Carbon2Chem®
»Methanol ist ein Grundstoff, der sich vielseitig einsetzen lässt und – aus CO2 und grünem Wasserstoff hergestellt – als klimafreundlicher Energieträger großes Potenzial bietet«
Innovative Verfahren zur Methanol-Synthese aus industriellen kohlenstoffhaltigen Gasströmen der Industrie optimieren – so lautet die Zielsetzung des Carbon2Chem®-Teilprojekts »Methanol«. Im Fokus stehen dabei die Arbeitspakete »Rohgase & Nutzungsoptionen«, »Gastrennung & Reinigung«, »Methanol-Synthese« und »Methanol-Downstream«. Wie die gewonnenen Erkenntnisse am Ende zu einer umfassenden Synthesestrategie zusammengeführt und in die Praxis übertragen werden, haben wir Matthias Kammel gefragt. Er leitet sowohl das Teilprojekt als auch den Innovationshub thyssenkrupp Carbon2Chem.

In meiner Wahrnehmung hat sich die Methanol-Synthese zum Herzstück von Carbon2Chem® entwickelt. War das bei Projektstart bereits absehbar?
Matthias Kammel: Zum Start des Projektes hatten wir in der Tat neben der Methanol-Synthese noch weitere Prozessrouten im Blick. Darunter die Herstellung von höheren Alkoholen, Oxymethylenether und Polymeren. Im Laufe von Carbon2Chem® hat sich dann herausgestellt, dass die Methanol-Route besonders vielversprechend ist. Ein Grund dafür ist, dass wir konkrete Ansatzpunkte haben, wie das Methanol nachher aufgereinigt in den Verkehrssektor eingebracht werden kann. Methanol ist ein Grundstoff, der sich vielseitig einsetzen lässt und – aus CO2 und grünem Wasserstoff hergestellt – als klimafreundlicher Energieträger großes Potenzial bietet.
In der dritten Phase liegt also jetzt der Fokus auf der weiteren Entwicklung der Methanol-Route?
Matthias Kammel: Ganz genau. Wir konzentrieren uns darauf, die Prozesse so weiterzuentwickeln, dass sie stabil laufen – und zwar auch über Langzeitversuche, die wir im kommenden Jahr vornehmen werden.
Unser Ziel: die Anlagen so aufzusetzen und zu betreiben, dass wir langfristig eine gute Qualität des Methanols gewährleisten können. Die Prozesssicherheit, insbesondere auch auf wechselnde Bedingungen der Einsatzstoffe, spielt dabei eine zentrale Rolle, denn nur so können wir die Anforderungen der Industrie erfüllen und die Ergebnisse zuverlässig in die Praxis bringen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung der Prozesse: Wir gehen vom Rohmethanol über die Methanol-Aufreinigung und Destillation zum technischen reinen Methanol, welches dann als Einsatzmedium zur Herstellung von Flugkraftstoff dient. Dafür wird eine Flugkraftstoffanlage in die Prozesskette integriert, sodass wir die gesamte Wertschöpfungskette abbilden können – von den CO₂-haltigen Gasen und grünem Wasserstoff am Anfang bis zum fertigen Flugkraftstoff, der später in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden kann. Das ist eine spannende Herausforderung, denn wir müssen nicht nur die chemischen Prozesse beherrschen, sondern auch die Anlagen so gestalten, dass sie in den industriellen Maßstab skalierbar sind.
Gibt es schon potenzielle Abnehmer für die Produkte?
Matthias Kammel: Wir sind natürlich schon mit potenziellen Abnehmern im Gespräch. Was den Flugkraftstoff betrifft, sind wir über ein anderes Projekt auch mit den Betreibern von Flughäfen und Fluggesellschaften sowie Turbinenherstellern in Kontakt. Am Ende des Tages wird genau für diesen Zweck ein Treibstoff neu »designed« – ein sogenannter Sustainable Aviation Fuel (SAF). Sustainable Aviation Fuels sind speziell dafür konzipiert, die CO₂-Emissionen im Luftverkehr zu senken und gleichzeitig auch die Umweltbelastung bezüglicher sogenannter non-CO2-Effekte zu reduzieren, so soll z.B. auch die Bildung von Kondensstreifen mitigiert werden.
Konkrete Abnehmer des Methanols gibt es auch in der Schifffahrt, wo Methanol unmittelbar und ohne weitere Syntheseschritte als Kraftstoff eingesetzt werden kann. Dies gilt besonders im Bereich der Kreuzfahrtschiffe, aber auch bei Transportschiffen lässt sich Methanol als umweltfreundlicherer Kraftstoff nutzen. Auch hier reduziert der Einsatz von Methanol Emissionen wie Rußpartikel oder Schwefeloxide im Vergleich zum üblichen Schweröl. Darüber hinaus gibt es noch einen kleineren Sektor, den wir ebenfalls im Auge haben: außerhalb der Elektromobilität im Fahrzeugbereich. Also überall dort, wo es aufgrund spezieller Anforderungen nicht möglich ist, auf Elektrifizierung zu setzen. Zum Beispiel im Rennsport.
Da steht also schon ein konkretes Geschäftsmodell für die Zeit nach Projektende hinter?
Matthias Kammel: Definitiv! Nicht nur nach der Phase 2, sondern auch in der Phase 3 nutzen wir alle möglichen Kontakte zur Industrie – sowohl zu den Partnern, die direkt bei Carbon2Chem® eingebunden sind, als auch zu Unternehmen außerhalb des Verbundvorhabens. Unser Ziel ist es, schon jetzt konkrete Projekte und Business Cases aufzusetzen, bei denen wir sagen: Nach der Förderphase, also nach dem Jahr 2028, werden wir diese Projekte tatsächlich umsetzen und am Markt realisieren.
Gerade im Bereich Flugkraftstoff sehen wir großes Potenzial, weil die EU für Fluggesellschaften klare regulatorische Vorgaben macht. Die Airlines sind verpflichtet, den Anteil nachhaltiger Flugkraftstoffe – kontinuierlich zu erhöhen. Das beginnt mit einer verpflichtenden Beimischungs-Quote von zwei Prozent ab Januar 2025, welche bis zum Jahr 2050 auf 70 Prozent steigen wird. Das heißt, es entsteht ein Markt, der unser nachhaltiges Flugbenzin, das auf Basis von Methanol hergestellt wird, aktiv nachfragt.
Ist thyssenkrupp Carbon2Chem zu diesem Zweck gegründet worden?
Matthias Kammel: Nicht direkt. Wir haben thyssenkrupp Carbon2Chem aufgesetzt, weil wir hier alle Dinge im Gesamtprojekt koordinieren – zum einen gegenüber dem Fördermittelgeber, zu den Instituten, aber auch zur Industrie. Wir verstehen uns als Innovations-Hub, also als zentrale Plattform, auf der wir viele Beteiligte an einen Tisch bringen und über unsere Kontakte konkrete Projekte initiieren.
Am Ende ist es aber immer die Industrie, die die Projekte tatsächlich umsetzt – bei uns im eigenen Haus zum Beispiel thyssenkrupp Uhde oder auch andere Unternehmen wie thyssenkrupp nucera. Unsere Aufgabe ist es, mit dem Carbon2Chem®-Technikum einen ersten Kontaktpunkt zu schaffen, an dem wir zeigen können: So funktioniert es schon! Aus unserer Erfahrung mit den vielen Besucherinnen und Besuchern im Technikum ist das der größte Beitrag, den wir leisten können. Damit schaffen wir die Grundlage, dass die Industrie unsere Forschung und Entwicklungen praxisnah übernehmen und weiter ausbauen kann.
Das heißt: Das Interesse sowohl am Methanol als auch an den Folge-Technologien auf Basis von Methanol ist groß?
Matthias Kammel: Das Interesse ist weltweit riesig. Wir bekommen ständig Anfragen, und das internationale Publikum ist wirklich beeindruckend. Zwei- bis dreimal pro Woche haben wir Besichtigungen im Technikum – und zwar aus allen möglichen Bereichen, oft auch hochkarätig besetzt. Das reicht vom amerikanischen Erdölförderer, der sehr daran interessiert ist, CO₂ in den USA nutzen zu können, bis zu Unternehmen aus Japan, dem Nahen Osten, Südamerika oder Australien. Viele mit idealen Rahmenbedingungen, um unsere Lösungen wirtschaftlich umzusetzen. Denn wir dürfen nicht vergessen:
Für alle diese chemischen Prozesse braucht man am Ende des Tages genug erneuerbare Energie. Die findet man vor allem in Ländern, die aufgrund ihrer natürlichen Gegebenheiten – viel Sonne und Wind – optimale Voraussetzungen bieten. Für alle Anwendungsbereiche ist das langfristige Ziel, einen geschlossenen Kohlenstoff-Kreislauf zu erreichen, und Carbon2Chem® bildet hier die Brücke, die den Weg von der CO2-Reduktion bis hin zum geschlossenen Kohlenstoff-Kreislauf eröffnet.
Wie schätzen Sie die Aussichten ein, die entwickelten Technologien in Deutschland oder Europa umzusetzen?
Matthias Kammel: Hier sehen wir einiges Potenzial. Im Norden Europas, also in skandinavischen Ländern, haben wir schon gute Voraussetzungen, was die erneuerbaren Energien betrifft. Hier kommt das Thema Wasserkraft noch hinzu – neben der Windkraft, die zum Beispiel in Dänemark stark vertreten ist. Die Wasserkraft ist eine wichtige Quelle, weil es bei diesen Prozessen darauf ankommt, eine stetige Energiebereitstellung zu gewährleisten. In Südeuropa gibt es ebenfalls großes Potenzial für erneuerbare Energien, hier mehr im Solar- und Windbereich. Aber die Umsetzung erfolgt von Land zu Land mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Was sind in Ihren Augen die größten Hindernisse bei der Umsetzung?
Matthias Kammel: Zum einen ist es so, dass wir mit den Prozessen und Technologien, die wir gerade entwickeln, industrieübergreifend arbeiten. Das führt dazu, dass man verschiedene Partner zusammenbringen muss – und das ist eine echte Herausforderung, weil die herkömmlichen Geschäftsmodelle hier nicht greifen. Es müssen neue Vereinbarungen getroffen werden, damit alle Beteiligten zusammenarbeiten können. Beispielsweise muss Betreibern »klassischer« Industrien mit hohem CO2-Ausstoß erst einmal klar werden, dass diese Emission auch als Rohstoff dienen kann. Das erfordert schon ein ziemliches Umdenken.
Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Voraussetzung. Am Ende geht es immer darum, einen Business Case aufzusetzen, also ein Geschäftsmodell, das sich auch lohnt und Renditen abwirft. Das kann funktionieren, wenn die regulatorischen Märkte – zum Beispiel durch höhere CO₂-Zertifikatspreise – entsprechend entwickelt werden. Die Herausforderung ist also, den richtigen Zeitpunkt für Investitionen und den Einstieg zu finden, damit sich das am Ende auch lohnt. Das ist ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip: Wann kommt die Regulatorik, wann kommen die ersten Kunden, wer macht den ersten Schritt? Das ist ähnlich wie beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur: Man braucht einen Abnehmer, zum Beispiel die Stahl- oder Chemieindustrie, aber auch die Lieferanten für Pipelines und Wasserstoffproduktion. Momentan funktioniert das Zusammenspiel noch nicht optimal, weil die Abläufe und Verantwortlichkeiten nicht klar sind und sich Projekte oft verzögern.
Sie sind seit Beginn bei Carbon2Chem® dabei: Hat das Projekt den Verlauf genommen, den Sie erwartet haben?
Matthias Kammel: Am Anfang habe ich das Projekt eher aus der Finanzperspektive begleitet, was mir jetzt hilft, Zusammenhänge besser einzuordnen. Und ich bin schon erstaunt, wie weit Carbon2Chem® gekommen ist und welchen Impact es hat – vor allem mit Blick auf Wirkung und Außenwirkung. Ich habe es eben geschildert: Sehr viele sind an unseren Ergebnissen interessiert. Heute zum Beispiel haben wir noch mal einen spannenden Austausch mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, die sich mit neuen Technologien und Start-ups beschäftigt.
Was ich mitgenommen habe, ist, dass wir als Vorreiter zeigen können, was wir seit 2016 aufgebaut haben: Dass man einfach mal Dinge angeht, Geld bereitstellt und sie dann auch umsetzt, statt sich vorher zu viele Gedanken zu machen, was hätte, was könnte, was müsste. Einfach mal machen! Das ist auch das Thema, das uns mit der Sprunginnovation verbindet – wir haben einfach etwas umgesetzt, hingestellt, gemacht und durchgezogen. Wir haben uns nicht von dem Weg abbringen lassen, auch wenn von links und rechts Stimmen kamen, die sagten: Das bringt nichts, das hat keinen Sinn.
Das ist, glaube ich, eine echte Lesson Learned: Diese Hartnäckigkeit von allen Seiten, auch von den Forschungsinstituten, immer wieder nach vorne zu bringen und zu zeigen: Guck mal, wir können da was machen – und in Deutschland ist das noch möglich. Das ist wirklich außergewöhnlich und einzigartig, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Für mich ist das ein Beweis, wie wichtig es ist, innovative Forschung und praxisnahe Umsetzung zu verbinden und gemeinsam mit starken Partnern neue Wege zu gehen.
Gibt es weitere Lessons Learned?
Matthias Kammel: Dass Begeisterung und Zusammenhalt im Team immer das Wichtigste sind – das sehen wir bei Carbon2Chem® jeden Tag. Denn in einem Projekt dieser Art, mit Förderungen und vielen Beteiligten, ist vieles stark durchreglementiert. Das betrifft nicht nur die Industrie, sondern auch die Forschungsinstitute. Da ist der Teamgeist enorm wichtig, um auch diese formalen Hürden eine nach der anderen zu nehmen.
Das ist für mich eine wichtige Erkenntnis: Die Herausforderungen sind über die Jahre nicht kleiner geworden – und trotzdem haben wir bei Carbon2Chem® gezeigt, wie viel möglich ist, wenn man mit Begeisterung und Hartnäckigkeit an einem Ziel arbeitet.
Was sind nächste Schritte, die Sie angehen wollen?
Matthias Kammel: Wir wollen jetzt zukünftig die dritte Phase von Carbon2Chem® auch nutzen, um gezielt Start-ups mit einzubinden. Uns ist wichtig, diesen jungen Unternehmen eine Plattform zu bieten, damit sie sich beteiligen können oder einfach mal sehen, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, der Austausch ist enorm wertvoll – gerade, wenn man von außen noch einmal einen anderen Blick auf das Projekt bekommt.
Natürlich sind wir im Projektteam schon lange zusammen und arbeiten immer mit dem gleichen Fokus. Da fällt es manchmal schwer, nach links und rechts zu schauen und wahrzunehmen, was es außerhalb von Carbon2Chem® noch für spannende Projekte und Ideen gibt. Aber genau das möchten wir jetzt verstärkt angehen: Offen sein für neue Impulse, den Dialog suchen und gemeinsam innovative Ansätze weiterentwickeln.
Haben Sie da schon Formate im Kopf?
Matthias Kammel: Wir werden mit SPRIND ein neues Format aufsetzen. Vermutlich im November. Dazu werden wir sechs bis sieben Teams einladen, die eine Art Pitch machen und vorstellen, was sie gemeinsam mit uns umsetzen könnten.
Uns ist wichtig, dass wir mit solchen Formaten eine Plattform schaffen, auf der sich Start-ups und Forschungseinrichtungen austauschen und gemeinsam neue Ideen entwickeln können. So bringen wir frische Impulse in das Projekt und fördern die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und jungen Unternehmen. Ich glaube, gerade dieser offene Austausch ist entscheidend, um innovative Ansätze für die nachhaltige Transformation der Industrie weiter voranzutreiben.
Letzte Änderung:
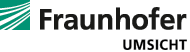 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT