Ausgangspunkt des Projekts bildet die Bestimmung der chemischen und thermophysikalischen Stoffeigenschaften der LD-Schlacke. Dafür werden mehrere Proben entnommen, im Labor homogenisiert, aufgemahlen und mit etablierten Verfahren detailliert untersucht. Darauf aufbauend erfolgen Laborversuche, mit denen die realen thermischen Bedingungen des Schlackebeets simuliert und die zuvor ermittelten Stoffdaten validiert werden können.
Mittels der ermittelten Stoffdaten und unter Berücksichtigung des derzeitigen Schlackendurchsatzes am Standort Duisburg werden thermodynamische Berechnungen zur Bestimmung der potenziellen Wärmeabgabe der Schlacke und der Wärmeaufnahme eines Strahlungs-Receivers durchgeführt. Auf dieser Basis wird ein dynamisches Simulationsmodell erstellt, um die diskontinuierliche Abwärmenutzung und deren Integration in das bestehende Fernwärmenetz sowie verschiedene Kombinationen von Sekundärfluiden, Wärmeübertragergeometrien und Wärmespeichern abzubilden und zu untersuchen.
Mithilfe der Erkenntnisse aus der Simulation und unter Berücksichtigung sicherheits- und genehmigungsrelevanter Aspekte wird ein Demonstrator zur effizienten Nutzung der Schlackenabwärme konzipiert. Der entwickelte Strahlungs-Receiver soll dabei weder die bisherigen Prozessabläufe noch die weitere werthaltige Nutzung beeinflussen. Auf dieser Grundlage wird ein Demonstrator errichtet und in Betrieb genommen. Neben den realen Betriebsdaten wird die abgekühlte Schlacke auf ihre Zusammensetzung und ihre physikalischen Eigenschaften untersucht, um eine Qualitätsbeeinflussung durch den Receiver auszuschließen.
Mithilfe der aus der Simulation und dem Demonstrator generierten Daten werden Wirtschaftlichkeits- und CO2-Analysen durchgeführt und das technische Potenzial abgeschätzt. Damit lassen sich die spezifischen Kosten für die Bereitstellung von Fernwärme aus der bisher ungenutzten, unvermeidbaren Schlackenabwärme abschätzen.
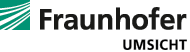 Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT